
Die wässerige Phase wird durch molekulare Kräfte an die Bodenpartikel gebunden. An den Grenzflächen von negativ geladenen Teilchen, die sich insbesondere in der Ton- oder Humusfraktion finden, etablieren sich elektrostatische Bindungen mit den Dipolen der Wassermoleküle. Zusätzlich wirken Van der Waals Kräfte und es können Wasserstoffbrücken mit den Sauerstoffatomen der festen Matrix auftreten [VanEyk, 1997]. Durch diese Adhäsionskräfte haftet ein dünner Wasserfilm an die Partikeloberflächen. Die inneren Schichten dieses Benetzungsfilms sind sehr stark gebunden, während sich die Bindungsstärke des Haftwassers nach außen hin reduziert.
Während Adhäsionskräfte an den Grenzflächen von zwei Phasen wirken, sind Kohäsionskräfte innerhalb einer Phase wirksam. Die zwischenmolekularen Bindungen von Wasser werden vor allem durch Van der Waals Wechselwirkungen gebildet. Kohäsive Bindungsenergien sind deutlich kleiner als die durch adhäsive Kräfte bewirkte Haftung des Wassers an Partikeloberflächen. Deshalb verdunstet bei austrocknenden Böden zunächst das Kapillarwasser.
Der Wassergehalt spielt bei der Simulation von Abbauvorgängen von Mineralölkontaminationen eine große Rolle. Die mikrobiologische Umsetzung findet ausschließlich in der wässerigen Phase statt. Sobald Teile des Bodens ausgetrocknet sind, kommt der Abbau zu Erliegen. Andererseits wird durch einen höheren Feuchtigkeitsgehalt die Sauerstoffdiffusion limitiert, da sich das luftgefüllte Porenvolumen verkleinert.
Verdunstungsvorgänge in Böden sind recht kompliziert. Kompostmieten unterscheiden sich von natürlichen Böden durch die fehlende Vegetation, die einen Teil der Bodenfeuchte durch Transpiration an die Atmosphäre abgibt. Desweiteren ist keine Grundwassersohle vorhanden, die oberflächennahe Bereiche mit Wasser durch Konvektions- und Diffusionsprozesse versorgt. Nachschub durch Niederschlag entfällt ebenfalls, da beim TERRAFERM-Verfahren die Böden in Hallen oder Zelten gelagert werden. Das führt auch dazu, dass starke Sonneneinstrahlung und ständiger Luftaustausch durch Wind ausbleiben.
Damit aus einer Kompostmiete Wasser verdunsten kann, muss genügend Energie
vorhanden sein. So sind zum Beispiel
![]() Joule pro Kilogramm
verdunstetem Wasser notwendig [Hillel, 1998]. Außerdem muss der Dampfdruck
über der Bodenoberfläche niedriger sein als in den Poren.
Joule pro Kilogramm
verdunstetem Wasser notwendig [Hillel, 1998]. Außerdem muss der Dampfdruck
über der Bodenoberfläche niedriger sein als in den Poren.
Das Ergebnis der Austrocknungsvorgänge in Bodenmieten ist ein Gradient von relativ trockenen Poren in der Nähe der Oberfläche zu relativ feuchten Poren im Innern. Es können mehrere Phasen der Bodenaustrocknung beschrieben werden, die sich durch ihre jeweils spezifische Kinetik charakterisieren lassen (für eine detaillierte Beschreibung siehe Hillel, 1998). Als Resultat lässt sich beobachten, dass eine Austrocknungsfront langsam in tiefere Bodenschichten wandert (Abb. 3.2).
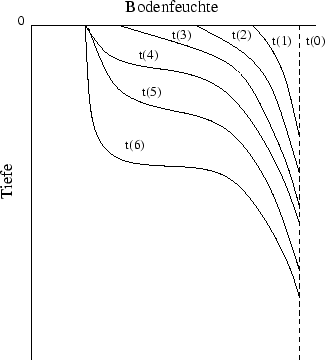 |
