| (3.16) | |
| (3.17) |

Im anoxischen Milieu können Paraffine prinzipiell durch Dehydrogenation degradiert werden. Die Reaktion könnte wie folgt verlaufen [VanEyk, 1997]:
| (3.16) | |
| (3.17) |
Auch wenn anerobe Abbauwege vom biochemischen Standpunkt aus als sehr interessant erscheinen, sind sie in der Sanierungspraxis aufgrund ihrer Langsamkeit mehr oder weniger irrelevant. VanEyk (1997) kommt zu dem Schluss:
,,At this moment in time it is not certain in how far anaerobic petroleum biodegradaton is of academic interest only. Judging from available histories of petroleum spills ..., it seems that the anaerobic biodegradation of petroleum hydrocarbons under natural conditions certainly does not contribute to any significant extent in their removal from soil.``
In dieser Arbeit wird angenommen, dass unter anoxischen Bedingungen kein anaerober Abbau stattfindet.
Der aerobe Abbau von Mineralölkohlenwasserstoffen ist abhängig von einer ausreichenden Versorgung mit atmosphärischem Sauerstoff. Diesem kommt bei der Biodegradation eine Doppelfunktion zu: er dient zum Einen als terminaler Elektronenakzeptor bei der Atmung, zum Anderen ist molekularer Sauerstoff direkt bei der Umsetzung des Kohlenwasserstoffmoleküls beteiligt.
Von den Bakterien genutzt werden kann nur der im Porenwasser gelöste Sauerstoff. Dessen Konzentration kann mit dem Henry'schen Gesetz ermittelt werde, das eine lineare Beziehung zum Partialdruck über der Lösung herstellt.
![]() ist die Henry´sche Konstante, sie hat unter Standardbedingungen einen
Wert von 0.0013 mol/(kg * bar) [Lide and Frederikse, 1995].
ist die Henry´sche Konstante, sie hat unter Standardbedingungen einen
Wert von 0.0013 mol/(kg * bar) [Lide and Frederikse, 1995].
Prinzipiell erfolgt die Oxydation von MKWs immer nach dem gleichen Schema. Im Folgenden wird der Abbau eines n-Alkans näher erläutert.
Zuerst wird ein Sauertoffatom reduziert und terminal am Ende der Kette eingebaut. Durch diese Hydroxylierung entsteht ein Alkohol [Singer and Finnerty, 1984]:
Die Hydroxylierung wird durch eine Monooxygenase, ein komplexes Enzymsystem, katalysiert. Neben dieser besteht noch die Möglichkeit der Oxydation eines Kohlenwasserstoffmoleküls durch eine Dioxygenase. Bei dieser Reaktion wird zunächst n-Alkyl Hydroperoxid gebildet, welches dann zu einem Alkohol metabolisiert wird (Hydroperoxydation).
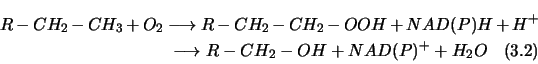
Die Oxydation des Kohlenwasserstoffmoleküls ist der entscheidende Schritt beim aeroben Abbau. Anschließend findet eine Weiteroxydation des primären Alkohols zu einem Aldehyd und schließlich zu einer Fettsäure statt. Als Endprodukt der Veratmung von Kohlenwasserstoffen ensteht CO2. Allerdings kommt es im Boden nicht notwendigerweise zu einer vollständigen Mineralisierung. Lotter (1995) weist darauf hin, dass Zwischenmetabolite in die Huminstoffmetabolisierung eintreten können und dann einem weitergehenden Abbau längere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Aspekte der Bioverfügbarkeit werden in Abschnitt 3.4 angesprochen.
Kurzkettige Moleküle, die weniger als 9 Kohlenstoffatome haben, sind schwerer abzubauen als ihre langkettigen Verwandten. Hoffmann und Viedt (1998) führen dies auf die höhere Wasserlöslichkeit zurück, die eine toxische Wirkung zur Folge hat und die Cytoplasmamembran schädigen könnte. Allerdings nimmt bei langkettigen Molekülen die Wasserlöslichkeit stark ab, so dass ab einer Kettenlänge von 20 wieder ein verminderter Abbau beobachtet werden kann. Desweiteren können geradkettige Verbindungen schneller abgebaut werden als verzweigte, welche wiederum schneller metabolisiert werden als Isocyclen.
